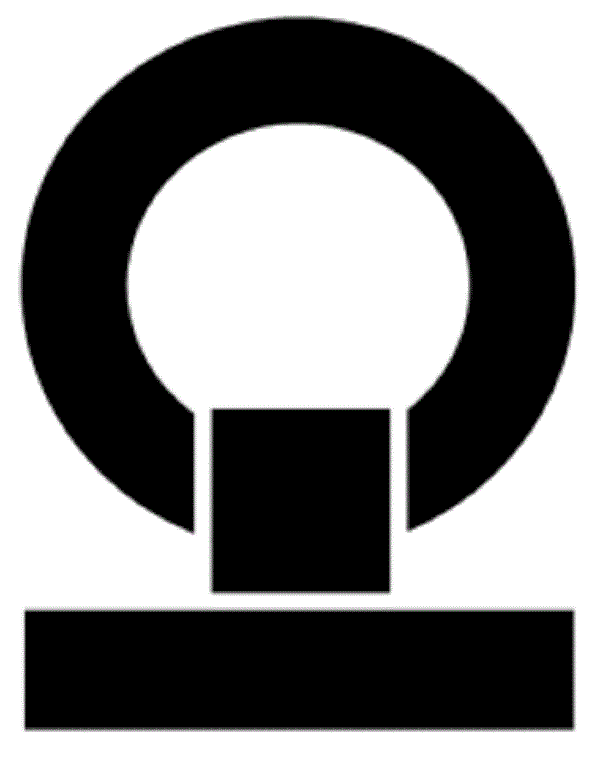Wer heute vom Linzer Ausflugshausberg, dem Pöstlingberg, oder aber auch vom Freinberg – zum Beispiel von der Franz Josefs-Warte aus – seinen Blick am Horizont in Richtung voestalpine schweifen lässt, der wird sich kaum vorstellen können, dass dort vor über 80 Jahren ein großes Augebiet und das Dorf St. Peter-Zizlau lag.
Dieses Kleinod war ein schmuckes, still-verträumtes Audorf, das etwa im weiteren Verlauf der verlängerten Franckstraße zwischen dem Hochofen I und der Sauerstoffanlage an einem langgestreckten Altwasserarm der Donau lag.
Es war umgeben von Obstgärten, fruchtbaren Feldern und grünen Auen. Trotz der doch unmittelbaren Nähe zur Stadt bewahrte es sich seinen ausgesprochen ländlichen Charakter. Dadurch zählte St. Peter-Zizlau seinerzeit zu den wohl beliebtesten Ausflugsmöglichkeiten in der näheren Umgebung von Linz. Befragte man in früheren Jahrzehnten ältere Linzerinnen und Linzer nach St. Peter, erhielt man meist die gleichen Antworten serviert, nämlich von den herrlichen Erinnerungen an die Kindheit und Jugend und an die ersten Erlebnisse mit der noch jungen Liebe und der ewigen Treue, die man sich oftmals dort schwor.
Verschmitztes Lächeln der Befragten ließ dann darauf ohnehin auch unausgesprochen bei weitem mehr erahnen, als jedes gesprochene Wort wohl auszudrücken vermochte. Der Mühlbach an der Zizlau lockte die Menschen zu einem erfrischenden Bad. Aber auch Schifferlfahren auf der alten Donau bereitete Freude und großen Spaß.
Die Buben erkoren die Donauauen von St. Peter als ihre „ewigen Jagdgründe“ aus, wo sie im dichten Gestrüpp auf Kriegspfad gingen. Und für die Familienväter galt es als das höchste Glück, an Sonn- und Feiertagen bei herrlichem Wetter mit Kind und Kegel per pedes nach St. Peter zu marschieren, um sich dann nach diesem ausgedehnten Fußmarsch bis weit vor die Tore der Stadt in einem der Gasthöfe niederzulassen. Die Wirtsleute dort vermochten ihre Gäste bei Most und Bier, aber auch bei herrlichen Fleischspeisen immer wieder aufs Neue zu verwöhnen.

Bis eines Tages mit einem einzigen Keulenschlag der Geschichte diese Idylle jäh zerstört wurde …
Schon kurz nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in den März-Tagen des Jahres 1938 war wieder Ruhe in der Bevölkerung eingekehrt. Man war froh, dass alles ohne großes Blutvergießen anhand des sogenannten „Anschlusses Österreichs an Hitler-Deutschland“ abgelaufen war. Freilich waren die Meinungen über die letzten Tage und Wochen geteilt und reichten von Euphorie bis hin zu Widerwillen und Angst.
Sehr bald schon begann man mit der Arbeitsbeschaffung. Alle Arbeitswilligen konnten kurzfristig Beschäftigung finden. Zwar nicht immer im erlernten Beruf, aber was machte dies schon jenen, die jahrelang arbeitslos oder bereits ausgesteuert waren, aus? Jede Arbeit wurde gerne angenommen.
Und so fand am Freitag, 13. Mai 1938 der pompöse Spatenstich der „Reichswerke Hermann Göring Linz“, für das große Industrieunternehmen der damaligen „Ostmark“, statt. Als günstige Lage hatte man das Gebiet südöstlich von Linz, die Ortsbereiche St. Peter-Zizlau festgelegt. Ohne lange Ablöseverhandlungen hatte man kurzfristig die Bevölkerung der beiden Ortschaften ausgesiedelt und deren Häuser, soweit sie den beginnenden Bautätigkeiten im Wege standen, dem Erdboden gleichgemacht. Den Abgesiedelten hatte man vorläufig Ersatzwohnungen zur Verfügung gestellt, bis die Wohnungen für die Aussiedler im Bereich der Wiener Reichsstraße – seit 1968 Wiener Straße in Linz – fertiggestellt waren.
Ähnlich verhielt es sich übrigens im niederösterreichischen Allensteig. Jene Ortschaft im Waldviertel galt als Kältepol Europas. Dort wollte Adolf Hitler seine Truppen für das „Unternehmen Barbarossa„, den Feldzug nach Osten, vorbereiten. Der „Führer der Deutschen Nation“ bedachte dabei jedoch nicht, dass es im russischen Winter um ein vielfaches kälter und ungemütlicher ist, als in Mitteleuropa. Auch in Allensteig wurden ganze Ortschaften abgesiedelt und die zurückgebliebenen leerstehenden Häuser für militärische Übungszwecke im Nah- und Häuserkampf „umgewidmet“.
Zurück nach St. Peter-Zizlau: Wer ein Haus hatte, bekam im aufstrebenden Stadtteil Keferfeld ein Ersatzhaus zugeteilt. Die Ausstattung der Wohnungen und Häuser war zum damaligen Zeitpunkt sehr modern, um nicht zu sagen komfortabel. Das ursprüngliche Entsetzen über die urplötzlich verlorene Heim- und Wohnstätte wich sehr bald schon der Freude über den neuen Wohnkomfort. Da nahm man sogar in Kauf, dass man bis zur Fertigstellung der neuen Häuser mindestens für ein Jahr in Ausweichquartieren und Baracken unterkam. Jene Barackenlager schossen von nun an rund um das neue Werk wie die Pilze aus dem Boden.
Sofort nach dem Spatenstich samt Baubeginn im Werksgelände ging man daran, je nach Reihenfolge der zu errichteten Betriebe entsprechende Facharbeiter aus ganz Österreich zur Arbeit nach Linz zu lotsen. So bald eine Werkstätte fertig gestellt war, war auch schon das Personal dafür vorhanden und einsatzbereit. So mancher Facharbeiter aus Donawitz, Kapfenberg, Eisenerz oder Wien kam in Linz als Führungspersonal zum Arbeitseinsatz. Ledige bekamen in einer der im Werk aufgestellten Unterkünfte ein Zimmer, verheiratete Österreicher oder Deutsche hatte man in Wohnungen im neuen Siedlungsgebiet Spallerhof, Bindermichl, Kleinmünchen oder Keferfeld, später auch in der Neuen Heimat, untergebracht.

Demzufolge explodierte die Bevölkerungszahl in Linz geradezu. Die wirtschaftliche Flaute der 1930er Jahre war vergessen. Jeder hatte wieder Arbeit, konnte seine Familie ernähren und war somit zufrieden. Das Werk wuchs rasant. Bereits 1939 konnten einige Betriebe ihre Arbeit aufnehmen. Der Stahlbau wurde zuerst fertig, denn dieser musste von nun an am weiteren Aufbau der nächsten Betriebe mitwirken. Und das Werk wuchs und wuchs. Es hatte den Anschein, dass dort emsige Ameisen am Werkeln sind, die sich jedoch auch von einem „Hineinstochern“ in den Bau nicht aus der Ruhe bringen ließen. Es lief alles in geordneten Bahnen ab, auch wenn es für Außenstehende oftmals nach einem wilden Durcheinander aussah.
Die „Stahl-Kocher“ hatten Hochbetrieb und die Bauhandwerker mussten Fundamente betonieren. Rund herum nur Wiesen, Felder und Auen. Damals konnte sich wohl keiner ausmalen, wie das hier einmal aussehen würde, wenn alles fertig ist. An allen Ecken und Enden von St. Peter-Zizlau schossen Betonklötze in die Höhe, dazwischen wurde schon wieder mit Schotter aufgefüllt, 3 bis 4 Meter hoch. Das Material dazu holte man aus einem Gebiet nordwestlich von Zizlau aus dem Boden; hier sollte einmal der Werkshafen entstehen.
Auch auf dem sozialen Gebiet wurde sehr viel getan und die Entlohnung war sehr gut. In der Werksküche wurde für die kräftigende Bewirtung gesorgt und man half somit dem kleinen Arbeiter oder aber auch dem Hilfsarbeiter beim gut leben und beim Sparen. Besonders attraktiv war jene Reklame: „Jedem Volksgenossen ein Haus (um 100.000,- Reichsmark) und einen Volkswagen (um 999,- Reichsmark).“ Viele Werksarbeiter sparten monatlich 5,- Reichsmark für das Auto an. Zum Leidwesen aller Sparer kam dieser aber wegen der inzwischen eingetretenen Kriegsereignisse – am 1. September 1939 erklärte Adolf Hitler Polen den Krieg, der Zweite Weltkrieg hatte damit begonnen – nicht mehr zur Auslieferung. Die Ansparer wurden auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet.
Der Krieg nahm immer verheerendere Folgen an, die Rüstung im inzwischen fertiggestellten Werk war in vollem Gange. Da jedoch viele Österreicher von den Betrieben abgezogen wurden, um in der Deutschen Wehrmacht zu dienen, wurden die fehlenden Arbeitsplätze durch Kriegsgefange und Frauen ersetzt. Die vor dem Krieg in der Creditanstalt-Bankverein am Taubenmarkt in Linz beschäftige, damals 28-jährige, Bärbel Dohnalek, inzwischen verheiratete Aglas, blickte in einem oepb-Gespräch in jene Jahre zurück: „Wir standen mitten im Krieg und die Straßenbahn hinaus ins Werk fuhr auch nicht. Es gab keine Schienen mehr, denn die Eisenstränge wurden demontiert, als „kriegswichtig“ eingestuft und eingeschmolzen. Zahlreiche Bombentrichter sorgten dafür, dass die „Elektrische“ nicht mehr fuhr. Also gingen wir allesamt stundenlang zu Fuß zur Arbeit. Ich fand in den „Eisenwerken Oberdonau“ eine Anstellung als Technische Zeichnerin. Wir hatten täglich Schicht, bis zu 12 Stunden. Mein Gatte Erwin, wir hatten 1943 geheiratet, war im Kessel von Calais und galt als vermisst. Ich wusste nicht, ob wir uns jemals wieder sehen würden. Aber die Arbeit und ein ungeheurer Wille zum Leben und zum Überleben begleitete mich durch jene Jahre. Viele meiner Kolleginnen zerbrachen an diesen Umständen oder suchten den Freitod.“
Die Arbeitszeit war inzwischen auf 60 Wochenstunden angewachsen. Auch samstags wurde „malocht“. Die Belegschaft im Werk bestand beinahe nur mehr aus Frauen, KZ-Häftlingen, oder Kriegsgefangenen, aber auch behindere und kriegswichtige Personen waren noch im Heimateinsatz. Dann begann das Bombardement der US-Luftstreitkräfte. Unermüdlich flogen die Amerikaner ihre Bombenangriffe auf das Werk. Wie ein Schwarm Hornissen zogen sie am Himmel auf und starteten Groß-Angriff auf Groß-Angriff. Alleine am 25. Juli 1944 fielen knapp 600 Bomben auf das Werk, die das ohnehin schon ramponierte Areal noch mehr dem Erdboden gleich machten. Zahlreiche Verletzte und Tote waren zu beklagen. Die NS-Propaganda-Maschinerie trug jedoch dazu bei, dass die Leute nicht gebrochen wurden und nach einigen Wochen die teilweise Produktion wieder aufgenommen werden konnte.
Als das Kriegsende nahte, machten sich einige beherzte Männer daran, die bereits von der Wehrmacht zur Sprengung von Werksanlagen eingebauten Bomben in mühevoller Arbeit und unter Einsatz ihres Lebens beiseite zu schaffen, um damit zu verhindern, dass die wertvollen und noch unzerstörten Anlagen nicht komplett vernichtet werden würden.
Am 5. Mai 1945 – am 8. Mai 1945 kapitulierte die Deutsche Wehrmacht – war der Krieg in Europa zu Ende. Die KZ-Gefangenen, die Kriegsgefangenen und auch die Deportierten aus den verschiedensten Staaten verließen das Werk und Linz. Niemand kümmerte sich in jener Zeit um die Anlagen und es wurde vieles, was nicht niet- und nagelfest war, gestohlen oder zerstört. Zurück blieb ein einziges Chaos. Keiner hatte damals geglaubt, dass hier jemals wieder irgendetwas produziert werden würde.
Der einstige Kranführer und spätere Zentralbetriebsratobmann der VÖEST, der SPÖ-Abgeordnete zum Nationalrat Franz Ruhaltinger wurde nie müde zu betonen, dass mit vereinter Muskelkraft und bloßen Händen das Werk, dass das ihre war, mühevoll im Kollektiv aus dem Dreck gezogen wurde. Als es wieder bergauf ging und er sich ein altes Fahrrad leisten konnte, mit dem er vom Spallerhof in die Schicht strampelte, fühlte er sich wie ein Kaiser.
Die Amerikaner besetzten die einstigen Eisenwerke Oberdonau und gaben diese 1946 an den österreichischen Staat zurück. Von nun an kehrte die emsige Betriebsamkeit in der künftigen VÖEST-ALPINE ins Werk zurück. Leitende ehemalige Angestellte gingen daran und kratzen noch in Linz lebendes und den Krieg heil überstandenes Personal zusammen und bildeten daraus eine neue Belegschaft. Unter dem Motto „Grabe, wo Du stehst!“ setzte die Instandsetzung wieder ein. Viele ehemalige Mitarbeiter, die aus dem Krieg nach Linz zurückkehrten, meldeten sich zur freiwilligen Mitarbeit. Und auch, wenn der Monatslohn damals zwischen 130,- und 150,- Schilling (€ 9,45 und € 10,90) lag, so war man einerseits froh, den schrecklichen Weltkrieg überlebt zu haben und andererseits guter Dinge, aktiv am Umstand „Auferstanden aus Ruinen“ mithelfen zu können.
Das Werk wurde im Frühling wieder grün, Bombentrichter wurden zugeschüttet, die Leute fanden wieder Arbeit und gemeinsam – um bei Franz Ruhaltinger zu bleiben – wurde das Werk aus dem Dreck gezogen, mit den bloßen Händen. Es ging wieder bergauf, mit der heutigen voestalpine und der Stadt Linz. Als bald 85-jähriger Jubilar steht das Werk nun da und will vertrauensvoll in die Zukunft blicken. Will an den Fluss des Lebens glauben und sich still den Erfordernissen anpassen, um gemeinsam mit einem starken Team – von der Konstruktion bis zur Montage – das Beste zu geben … echte VÖESTler eben!
GLÜCK AUF!
Quelle: Redaktion www.oepb.at
Anmerkung: Der weiter oben erwähnte und als „Vermisst“ gegoltene Unteroffizier Erwin H. Aglas kehrte im Winter 1946/47 als einer der letzten Deutschen Soldaten aus der englischen Kriegsgefangenschaft bei Sheffield nach Österreich und Linz zurück. Die Ehe mit Gattin Bärbel dauerte – bis dass der Tod sie schied – 55 Jahre lang, mit all ihren Höhen und Tiefen, die ein Eheleben eben so mit sich bringt.
Mehr zum Thema Leben für und Arbeiten in der VÖEST lesen Sie bitte anhnd dieser Buch-Rezension hier;
Und auch, wenn es die heutige Werksleitung der voestalpine nicht mehr gerne hört oder gar wahrhaben möchte – der Fußballsport des SK VÖEST Linz war einst ein echter und wichtiger Werbeträger, sowie ein Aushängeschild der VÖEST-ALPINE. Mehr dazu lesen Sie bitte hier;
Lesen Sie mehr über die oberösterreichische Landeshauptstadt Linz bitte hier;